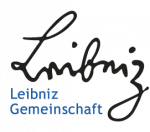Die neu eingerichtete Arbeitsgruppe will entschlüsseln, wie Umweltgifte, z.B. Partikel, Strahlung oder Chemikalien, den Alterungsprozess auf molekularer Ebene beschleunigen und die Entstehung damit verbundener Krankheiten befördern.
In der Vergangenheit hat der Gruppenleiter Multi-Omics-Methoden benutzt, um sogenannte alternative Tiermodelle der Alterungsforschung zu untersuchen. Dabei handelt es sich um Tierarten mit außergewöhnlichen Lebensspannen, die oft auch andere interessante Alternseigenschaften aufweisen. Wir analysierten z. B. Proben von sehr kurzlebigen Organismen wie Nothobranchius Killifischen ebenso wie von sehr langlebigen Arten wie Clownfischen und sogar von nicht-alternden Spezies wie Hydra. Dabei haben wir die Genome, Epigenome und Transkriptome dieser alternativen Tiermodelle oft mit denen eng verwandter Arten verglichen, die keine derart extremen Alterungsmerkmale aufweisen. Besonders interessieren wir uns für Sandgräber wie den Nacktmull. Dieser erreicht mit einer maximalen Lebensdauer von über 30 Jahren nicht nur ein für Nagetiere außergewöhnliches hohes Alter, sondern erkrankt auch fast nie an Krebs. Darüber hinaus variieren die Alternsraten und die Lebensspannen der Individuen stark in Abhängigkeit vom sozialen und reproduktiven Status innerhalb der Kolonie.
Als Bioinformatiker arbeiten wir eng mit einer Reihe von zoologischen Forschungsgruppen zusammen, die alternative Modellorganismen halten. Ergänzend zu unseren Datenanalysen entwickeln wir neue bioinformatische Werkzeuge und Methoden, wie z. B. Pipelines zur genomweiten Erkennung von positiv selektierten Organismen und Modelle zur Untersuchung epigenomischer Evolution.
In Zukunft wollen wir unsere Evolutionsmodelle einsetzen, um herauszufinden, welche genetischen und epigenetischen Anpassungen es bestimmten Arten ermöglichen, extremen Umweltbelastungen zu trotzen. So können Nacktmulle beispielsweise Kohlendioxidkonzentrationen aushalten, die sowohl für eng verwandte Arten als auch für den Menschen tödlich wären.
Zudem werden wir unsere Multi-Omics-Methoden auf einzigartige Probensätze des IUFs anwenden, um Gene und Signalwege zu identifizieren, die durch den Einfluss von Umweltgiften verändert werden. Insbesondere werden wir uns auf epigenetische Veränderungen konzentrieren, die die Genregulation längerfristig verändern, d. h. möglicherweise über den Zeitraum der tatsächlichen Exposition hinaus. Zu diesem Zweck werden wir Proben aus Zellkulturen und Tiermodellen sowie von Menschen bioinformatisch untersuchen, die z. B. Luftverschmutzung, Neurotoxinen oder Strahlung ausgesetzt waren.
Nachwuchsgruppenleiter:
Arne Sahm
Epigenetische Alterungssignaturen durch chronische CO2-Exposition bei Nacktmullen
Erhöhte Kohlendioxid (CO2)-Konzentrationen stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Über die molekularen Mechanismen und Anpassungsreaktionen ist jedoch noch wenig bekannt. Nacktmulle (Heterocephalus glaber) sind insofern ein aussagekräftiges Tiermodell, da sie wie der Mensch außergewöhnlich langlebig sind. Nacktmulle können jedoch eine viel größere Bandbreite an CO2-Werten tolerieren, einschließlich stark hypoxischer Bedingungen, die für den Menschen tödlich wären. Daher werden wir sowohl in Haltung als auch in freier Wildbahn lebende Kolonien untersuchen, indem wir die in ihren Bauen gemessenen CO2-Konzentrationen mit den entsprechenden epigenetischen Veränderungen in Beziehung setzen. Um die Gene und Signalwege zu identifizieren, deren transkriptomischer und epigenetischer Zustand als Reaktion auf eine langfristige Exposition gegenüber hohen CO2-Werten angepasst wird, werden wir RNA-seq, ATAC-seq und RRBS auf Hautbiopsien anwenden. Schließlich werden wir die epigenetischen Daten erneut nutzen, um zu quantifizieren, inwieweit erhöhte CO2-Konzentrationen den Alterungsprozess dieses langlebigen Tiermodells beschleunigen, indem wir die Daten mit einer epigenetischen Uhr auswerten. Das Projekt wird im Rahmen des Leibniz-Forschungsverbundes „Resilient Ageing“ gefördert.
National:
Thomas Hildebrandt und Susanne Holtze, Leibniz-IZW, Berlin
Steve Hoffmann, Martin Fischer und Marco Groth, Leibniz-FLI, Jena
Sabine Begall und Philipp Dammann, Universität Duisburg-Essen
Pascal Malkemper, Max-Planck-CAESAR, Bonn
Helmut Pospiech, Universitätsklinikum Düsseldorf
International:
Alessandro Cellerino, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italien
Postdoc